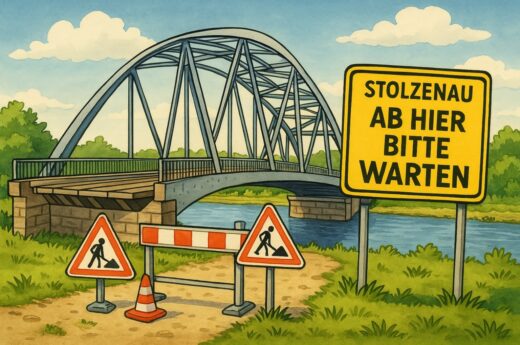Bundeswehr ja, aber bitte ohne Krieg - Wie sieht es in der Clausewitz-Kaserne in Langendamm aus?

Immer mehr freiwillige Soldaten scheinen erst nach Dienstantritt zu merken, dass Uniform nicht nur fürs Gruppenfoto da ist. Was zunächst nach Abenteuer und Kameradschaft klingt, entwickelt sich offenbar für manche zur unbequemen Realität. Denn plötzlich geht es nicht mehr nur um Marschieren im niedersächsischen Nieselregen, sondern um konkrete Einsätze im Osten Europas. Aus verschiedenen Kasernen ist zu hören, dass die Zahl der Verweigerungsanträge deutlich gestiegen ist. Offenbar entdecken einige Rekruten ihr Gewissen erst dann, wenn auf dem Einsatzplan das Wort Litauen auftaucht.
In Zeiten freiwilliger Armee wirkt dieser Trend etwas schräg. Niemand wird gezwungen zur Bundeswehr zu gehen und doch melden sich immer mehr, um sich dann später auf das Grundgesetz zu berufen. Der Dienst an der Waffe scheint für einige nur dann tragbar zu sein, solange er rein theoretisch bleibt. Doch wer sich bei der Truppe für Technik, Teamgeist und Taktik interessiert, sollte vielleicht vorher einmal nachlesen, was Verteidigung im Ernstfall bedeuten kann. Manche scheinen überrascht zu sein, dass der Dienstherr nicht nur Feldbett und Kantine bereithält, sondern gelegentlich auch Aufträge mit Zielkoordinaten.
Wie sieht es eigentlich in der Clausewitz-Kaserne in Langendamm aus? Offizielle Zahlen dazu sind nicht bekannt, aber man wird ja wohl mal fragen dürfen. Gibt es auch hier schon Uniformierte, die lieber den Antrag ausfüllen als den Rucksack packen? Vielleicht ist der Gedanke an Litauen, 1200 Kilometer entfernt, dann doch etwas zu viel Realität für einige. Oder wird der Wehrdienst inzwischen als staatlich finanzierter Selbstfindungstrip verstanden, aus dem man bei Bedarf wieder aussteigen kann? Wenn das so weitergeht, muss sich die Bundeswehr bald fragen, ob sie nicht statt Gewehr und Helm besser warme Decken und Austrittsformulare austeilen sollte.